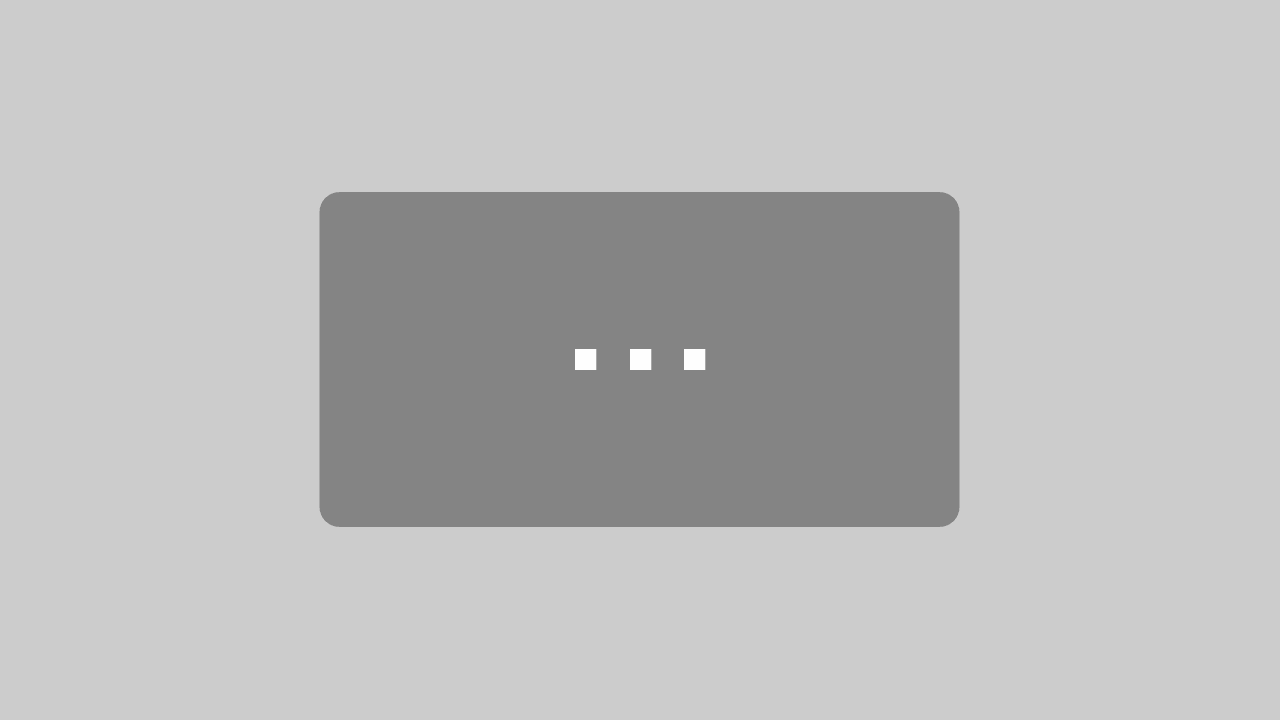Strenge Hierarchien, eine Führungskraft, die alle Entscheidungen trifft, Abteilungen und Meetings? Das alles braucht man als Unternehmen nicht, ist Detlef Lohmann überzeugt. Wenn Sie als Führungskraft Strukturen schaffen, in denen Ihre Mitarbeiter Verantwortung übernehmen dürfen, dann haben Sie endlich Zeit für das, was Führung eigentlich sein sollte. Lohmanns Buch «… und mittags geh‘ ich heim» (Linde Verlag) wurde auf der Frankfurter Buchmesse zum Managementbuch des Jahres 2012 gekürt. Er erzählt darin von seinen Erfahrungen als Führungskraft und wie er in seinem Unternehmen die klassische Organisationspyramide ordentlich auf den Kopf gestellt hat – praxisnah, sympathisch und sehr ehrlich.

business bestseller: In Ihrem Unternehmen setzen Sie auf flache Hierarchien bzw. eine umgekehrte Pyramide, auf der ganz oben der Kunde und ganz unten die Führungskraft steht. Eine solche Struktur impliziert, dass die Führungskraft viel Verantwortung abgibt. Wie schwer fiel es Ihnen, sich davon zu lösen und auf die Mitarbeiter zu vertrauen?
Detlef Lohmann: Das war auch für mich ein riesiger Schritt. Der tatsächliche Durchbruch war bei mir vor vier Jahren, mit der großen Krise 2008. Anfang 2009 hatten wir Umsatzeinbrüche von bis zu 50 Prozent. Da war mit klar, wenn wir profitabel bleiben wollen, dann müssen wir alle einen Beitrag leisten. Ich habe alle variablen Anteile aufgegeben, die ich zuvor als Manövriermasse hatte, und sie den Mitarbeitern als Festgehalt gegeben, wohlwissend, dass ich einige Wochen später ein Bitte an meine Leute haben werde: Ich habe mit dem Mitarbeitern gesprochen und sie gebeten, auf freiwilliger Basis auf ein Monatsgehalt zu verzichten.
Und zu erfahren, dass die Mitarbeiter in einer geheimen Abstimmung mit über 90 Prozent diesem freiwilligen Einbehalt zustimmten, das war für mich ein echter Vertrauensbeweis. Dieses Vertrauen, dass ich dabei an die Mitarbeiter geschenkt hatte, haben sie auch mir geschenkt und so sind wir gemeinsam aus der Krise gekommen – das war für mich der Schlüsselmoment.
Zusätzlich war zu beobachten, dass die Mitarbeiter wahnsinnig auf das Kostensparen eingestellt waren und enorm kostenorientiert arbeiteten. Das war eine neue Erfahrung für mich, hat letztendlich großartig funktioniert und mich überzeugt, dass ich meinen Mitarbeitern vertrauen kann.
Um seinen Mitarbeitern so viel Verantwortung zu übertragen, brauchen Sie Top-Leute. Wie gelingt Ihnen das in Zeiten von Fachkräftemangel?
Da gibt es einen dummen Spruch, aber der ist wahr: «Jeder hat die Mitarbeiter, die er verdient.» Und das stimmt tatsächlich. Wenn wir einem Menschen nichts zutrauen, wird er auch nichts leisten. Wenn wir ihm dagegen Vertrauen schenken und Macht geben, selbst etwas zu bewegen, dann werden wir erstaunt sein, was er alles erreichen kann.
Viele Menschen schalten zwei Drittel ihres Gehirns ab, wenn sie auf das Firmengelände kommen und folgen einfach stupiden Regeln, die eigentlich keinen Sinn machen. Man muss dem gesunden Menschenverstand wieder freie Bahn geben und dann können alle, auf jeder Ebene, Verantwortung übernehmen. Natürlich wird der kleine Arbeiter keine Investitionsentscheidungen treffen, aber über Dinge, die in seinem Kompetenzbereich liegen, kann er selbst am besten entscheiden – Brauche ich einen neuen Schraubenschlüssel oder nicht, brauche ich ein neues Teil oder lässt sich das alte noch reparieren?
Die Frage ist, trauen wir uns, unseren Mitarbeitern diese Freiheit zu geben. Da ich selbst grundsätzlich eher faul bin (lacht) und keine wirkliche Ahnung von den verschiedenen Bestellungen im Unternehmen hatte, habe ich einfach gesagt, das macht jeder selbst. Ich gebe ungefähr vor, was das ganze Jahr über ausgegeben werden darf und jeder Mitarbeiter trägt in eine Liste ein, wieviel davon er für Anschaffungen benötigt hat. Damit bekommen Sie eine Selbststeuerung im Unternehmen. Die Mitarbeiter sehen, ok, es ist noch Geld da oder nein, es ist nichts mehr da und überlegen dann selbst: «Brauche ich das wirklich?» Wenn Sie zu Ihrem Chef gehen und dem erklären müssen, warum Sie dies und das brauchen, kann er das oft gar nicht wirklich beurteilen und gibt es Ihnen. Wenn Sie selbst entscheiden dürfen, kann es sein, dass Sie in 50 Prozent der Fälle sagen: «Nein, so dringend brauche ich das eigentlich nicht.»
Worin besteht in einem so strukturierten Unternehmen dann noch die Aufgabe der Führungskraft?
Die Aufgabe der Führungskraft wird eine ganz andere. Während Führungskräfte früher zum größten Teil mit Sachführung beschäftigt waren, kümmert sich der Chef heute darum, dass eine gute Stimmung im Team herrscht.
Sie erzählen in Ihrem Buch auch, dass Sie jeden Morgen selbst die Post an Ihre Mitarbeiter verteilen.
Das mache ich hauptsächlich, um meinen Mitarbeitern Ansprechbarkeit zu signalisieren, meine Art den Menschen zu zeigen, jetzt bin ich bereit für irgendwelche Fragen und Probleme, über die ihr sprechen möchtet. Jetzt höre ich zu. Ich werde sie nicht für euch lösen, aber versuchen, Fragen zu stellen, die bei der Problemlösung helfen können. Die Führungskraft hat dadurch auf der einen Seite mehr Zeit, dafür zu sorgen, dass die Menschen sich im Unternehmen wohl fühlen, dass es Leitlinien gibt, dass die intrinsische Motivation – der innere Antrieb – nicht blockiert wird, und auf der anderen Seite hat die Führungskraft dafür zu sorgen, dass die Abläufe im Unternehmen immer besser und reibungsloser werden. Die Aufgabe ist es, den ganzen Prozess aus der Helikopterperspektive zu überblicken, um zu sehen, wo es stockt und nicht mehr zu sagen: «Du machst dies und du machst jenes.» Das wissen die Mitarbeiter selbst sowieso besser als der Chef.
Es besteht ein Risiko darin, sich als Führungskraft zurückzunehmen und die Mitarbeiter «machen zu lassen». Auch wenn die Linie, die das Unternehmen fährt, klar ist, kann es zu Entscheidungen kommen, die Sie als Führungskraft anders getroffen hätten. Wie gehen Sie damit um?
Die Schwierigkeit ist die, sich bewusst zurückzuhalten, wenn man das Gefühl hat, dass man selbst anders entschieden hätte und das nicht zu sagen. Nur Fragen zu stellen, warum der Mitarbeiter so gehandelt hat und es dann auch dabei zu belassen. Das ist extrem schwierig, vor allem dann, wenn ich überzeugt bin, dass eine Entscheidung wirklich nicht zielführend war. Aber es lohnt sich, diesen Prozess laufen zu lassen. Nur wenn Menschen ernst genommen und nicht ständig korrigiert werden, wird dieses System funktionieren. Es ist eine Frage der Selbstdisziplin und der Selbstreflektion. Und wenn ich festselle, da geht mir etwas gegen den Strich, lieber erst mal wegschauen und den Mitarbeiter das regeln lassen. Denn wenn Sie beim elften Mal einschreiten und sagen: «Nein, so nicht, das machen wir anders», zerstören Sie damit alles, was Sie die vorigen zehn Mal aufgebaut haben und es funktioniert nie wieder.
Es kann sein, dass einige Entscheidungen am Anfang dieses Prozesses «schlechter» ausfallen, als wenn Sie als Führungskraft mit Ihrer Erfahrung die Vorgehensweise bestimmt hätten, aber Sie werden sehen, von da an findet eine permanente Steigerung statt.
Im Buch erzählen Sie von Ihrem Besuch eines Unternehmens in Brasilien, dessen Firmengelände wie ein Hochsicherheitsgefängnis gesichert war, um sich vor Übergriffen von außen zu schützen. Ihnen wurde dort bewusst, wie extrem die Kluft zwischen Reich und Arm ist – so extrem, dass die Armen nichts mehr zu verlieren haben und die Reichen sich zur eigenen Sicherheit einzäunen müssen.
Sie sagen: «Wer als Unternehmer Gewinne maximiert, arbeitet auf Dauer für die Instabilität», verstärkt somit genau diese Schere. Wie können Sie als Unternehmer einer solchen Entwicklung entgegensteuern?
Ein Unternehmer sollte auch social responsibility für seine Leute übernehmen. Wir machen dafür zwei Dinge: Zum einen können die Mitarbeiter seit 2003 selbst Kapitalist werden, indem sie Genussscheine erwerben und damit am Gewinn direkt partizipieren. Das heißt, in der Vergangenheit haben sie dann ihren Genussschein zwischen 15 bis zu 35 Prozent Dividende in dem Jahr rentiert bekommen. Somit sind sie Kapitalisten wie ich und damit kann ich in einem gewissen Ausmaß Reichtum anders verteilen. Gleichzeitig werden in Deutschland Kapitaleinkünften geringer besteuert als die Einkünfte aus nicht-selbständiger Arbeit. Auf diesem Weg haben die Mitarbeiter bisher 450.000 Euro ins Unternehmen investiert. Das ist für mich als Unternehmer ein extrem teures Unterfangen. Während ich den Banken nur zwei bis drei Prozent zahlen müsste, bekommen die Mitarbeiter 20 bis 25 Prozent Dividende – wirtschaftlich also eigentlich ein Unsinn, aber die Rendite kommt über die emotionale Bindung zum Unternehmen und die daraus resultierende Leistungsbereitschaft zurück. Zum anderen gibt es in unserem Unternehmen seit 2008 eine Mitarbeitergewinnbeteiligung. Das heißt, ab einer gewissen Gewinnschwelle bekommen die Mitarbeiter zehn Prozent des Gewinns vor Steuern. Diese werden pro Kopf verteilt. Jeder Mitarbeiter besitzt dabei genau den gleichen Wert, ganz egal wie viel er verdient. Damit findet also auch ein Ausgleich statt. Und wenn eine weitere Schwelle überschritten wird, dann gehen 20 Prozent des Gewinns an die Mitarbeiter. Das hat dazu geführt, dass wir 2011 insgesamt 1,2 Millionen Euro an die Mitarbeiter gezahlt haben. Einfache Arbeiter, die im Jahr 26.000 oder 27.000 Euro verdient hatten, haben eine Prämie von 8.500 Euro bekommen. Das ist echte Umverteilung.
Nun haben wir noch eine neugierige Frage an Sie, Herr Lohmann. Gehen Sie tatsächlich mittags nach Hause?
Ja und nein. Mittags bin ich tatsächlich meistens zum Essen zu Hause und es kommt auch häufig vor, dass ich dann nachmittags gar nicht mehr ins Büro gehe. Vormittags bin ich vor Ort, um als Ansprechpartner verfügbar zu sein. Da die Mitarbeiter selbst entscheiden und das Unternehmen ohne meine ständige Einflussnahme läuft, habe ich nachmittags Zeit für strategische Überlegungen und Planungen – und die kann ich auch zu Hause im Garten oder an einem See machen.
Detlef Lohmann ist Inhaber und Geschäftsführer von «allsafe Jungfalk», einem Hersteller von Ladungssicherungssystemen. Das Unternehmen wurde 2012 bereits zum dritten Mal zum Top-Arbeitgeber im Mittelstand gekürt. bb-Redakteurin Christina Hackhofer sprach mit ihm auf der Frankfurter Buchmesse.